Servicenavigation
Suche
Eine sehr starke Gewitterzelle - eine sogenannte Superzelle - erreichte am 15. Juli 1985 am Abend die Station Glarus aus Westen
Am 15. Juli bildete sich gegen 18 Uhr Lokalzeit über dem Sempachersee eine sehr starke Gewitterzelle, sie zog über den Baldegger- und Zugersee zum Sihlsee. Dabei wurden in diesen Gebieten zum einen schwere Hagelschäden gemeldet. Aber auch abgedeckte Dächer und Windbruch waren die Folge. Das Gewitter verlagerte sich anschliessend in die Gegend von Glarus. Wohl wurde der durch den Downburst ohnehin starke Wind durch den Steilabfall bei Ausgang des Klöntales noch verstärkt. Der durch das Gewitter bedingte Wind traf wohl die Station Glarus mit voller Wucht. Zudem liegt die Station auf einer kleinen Anhöhe, was die Windgeschwindigkeit wahrscheinlich noch zusätzlich erhöhte. Diese Umstände erklären die extrem hohe Böenspitze von 190 km/h, welche in tieferen Lagen die höchste Windgeschwindigkeit für lange 38 Jahre darstellte, ehe dieser Wert am 24. Juli 2023 in La Chaux-de-Fonds überboten wurde. Selbst der katastrophale Wintersturm Vivian vom 27. Februar 1990, welcher im Glarnerland verheerende Waldschäden nach sich zog, brachte der Station Glarus eine Böenspitze von «nur» 169 km/h.

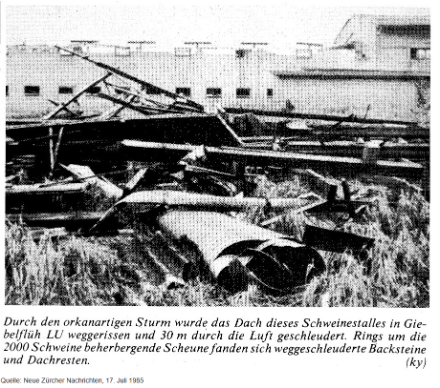
![Verlauf der Böenspitzen [km/h] in Glarus am 15. Juli 1985. Am Abend wurde die Station Glarus von einem äusserst heftigen Windstoss erfasst.](/images/440/blog/2025/07/Superzellen_15072025/B-e_Glarus.PNG/Boee_Glarus.png)
Wie kommt es zur Bildung einer Superzelle? Die wichtigste Voraussetzung ist die vertikale Windscherung
Zur Entstehung einer Superzelle sind mehrere Bedingungen erforderlich, die untenstehend beschrieben werden. Erstens einmal muss die atmosphärische Schichtung labil sein, damit Luftpakete überhaupt aufsteigen können. Dies gilt übrigens für alle Arten von Gewittern.
Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die vertikale Windscherung. Damit meint man eine Änderung der Windrichtung und -stärke mit zunehmender Höhe. Oft ist es so, dass bei Tagen mit Superzellen der Wind eine Rechtsdrehung mit der Höhe aufweist. Dies ist oft bereits durch die Bodenreibung gegeben. So weht als Folge der Reibung der Wind in Bodennähe nicht parallel zu den Isohypsen, sondern erfährt eine Ablenkung zum tiefen Druck hin. So kann oft festgestellt werden, dass bei westlichen Höhenwinden der Wind in den untersten Luftschichten aus Südwest weht. Anderseits ist es meist so, dass der Wind mit der Höhe auch an Stärke zunimmt. Auch dies ist nicht selten eine Folge der bodennahen Reibung. Häufig nimmt bei westlichen oder südwestlichen Winden, also bei jener Windrichtung, bei welcher häufig Superzellen auftreten, die Windgeschwindigkeit auch ohne Reibungsfluss mit der Höhe oft stark zu. Grund dafür ist im übrigen die im Süden wärmere Luft als gegen Norden hin, was den Druckgradient mit zunehmender Höhe ansteigen lässt.

Beschreibung der Windströmungen innerhalb einer Superzelle
Die in Bodennähe aus Südwesten wehenden Winde weisen, wie bereits erwähnt, ein Anstieg der Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe auf. Mit etwas Fantasie kann man sich vorstellen, dass es sich dabei um horizontal liegende Rollen handelt, welche sich von Südwest nach Nordost bewegen. Sobald nun die Luft aufzusteigen beginnt, werden diese horizontalen Rollen in vertikale Rollen umgewandelt. Die aufsteigende Luft rotiert also und zwar meistens im Gegenuhrzeigersinn.
Weil die allgemeine Windgeschwindigkeit mit der Höhe zunimmt, steht die Achse der rotierenden Aufwinde nicht senkrecht, sondern ist in die Verlagerungsrichtung der Gewitter geneigt, das heisst in den meisten Fällen nach Osten oder Nordosten. Die sich in der austeigenden und warmen Luft bildenden Niederschläge fallen deshalb ausserhalb des Warmluftstroms aus. Die Niederschläge, meist Hagel, kühlen die Luftschicht, durch welche sie fallen, oft markant aus. Die kalte Luft wird dadurch schwerer, beginnt abzusinken und dehnt sich in Bodennähe aus. Dabei können auch in Bodennähe kurzeitig hohe Windgeschwindigkeiten von über 150 km/h, im Extremfall sogar über 200 km/h auftreten. Dieses Phänomen - auch Downburst genannt, verursacht oft die grössten Schäden innerhalb einer Superzelle. Höhere Windgeschwindigkeiten in Bodennähe sind in Mitteleuropa nur noch bei Tornados zu erwarten, welche sich unter anderem ebenfalls innerhalb einer Superzelle bilden können. Windgeschwindigkeiten innerhalb Tornados sind allerdings schwer zu ermittelten, da die Messgeräte regelmässig zerstört werden, könnten aber durchaus 400 km/h und mehr erreichen.

Am 24. Juli 2023 hatte eine Superzelle in La Chaux-de-Fonds verheerende Auswirkungen
Am Morgen des 24. Juli 2023 kam ein Unwetter auf La Chaux-de-Fonds zu, welches die dortige Bevölkerung wohl nie vergessen wird. Eine Superzelle wanderte von Südwesten her auf die Stadt zu. Der damit verbundene Downburst löste kurzeitig extrem hohe Windgeschwindigkeiten aus. Die SwissMetNet-Station La Chaux-de-Fonds zeichnete dabei eine Böenspitze von 217 km/h auf. Die Schäden in der Stadt und in der näheren Umgebung waren ohne Übertreibung katastrophal. Viele Häuser wurden teilweise zerstört und zahllose Bäume geknickt oder entwurzelt. Auch viele Autos wurden völlig demoliert. Leider kam auch ein Mensch ums Leben. Möglicherweise hat ein Tornado innerhalb der Superzelle die Schäden noch erhöht.
