Servicenavigation
Suche
Während die Vorbereitungen auf den Millennium-Wechsel liefen und IT-Katastrophenszenarien diskutiert wurden, wurde die Schweiz am Stephanstag 1999 von einem unerwarteten Naturereignis getroffen: Orkan Lothar. Mit seiner aussergewöhnlichen Wucht übertraf der Sturm alle bisherigen Erfahrungen und richtete massive Schäden an.
Noch nie zuvor hatte ein Naturereignis in der Schweiz Schäden in Höhe von fast 1,8 Milliarden Franken verursacht. Besonders betroffen waren Wälder und Gebäude. 14 Menschen kamen während des Sturms ums Leben, mindestens 15 weitere bei den anschliessenden Aufräumarbeiten.
Am 26. Dezember 1999 markierte Orkan Lothar den Höhepunkt eines aussergewöhnlichen Wetterjahres, das bereits von einem Lawinenwinter und Überschwemmungen geprägt war. Zum 25. Jahrestag werfen wir einen Blick zurück auf dieses besondere Ereignis und seine weitreichenden Folgen.
07.20h: "Die Bodenbeobachtungen von 06 GMT laufen ein, Hauptaugenmerk Frankreich. In Rouen 25.8 hPa Druckabfall in drei Stunden! So etwas habe ich noch nie gesehen über dem Kontinent. Damit wird endgültig klar, dass sich Ausserordentliches anbahnt".
Meteorologe Gaudenz Truog, verantwortlicher Schichtleiter des Prognosedienstes am 26. Dezember 1999.
Die synoptische Entwicklung des Orkantiefs Lothar
Um die Entwicklung eines solch gewaltigen Sturmes wie Lothar zu verstehen, muss man die Grosswetterlage und die Vorgeschichte über dem Nordatlantik und Europa betrachten. Ab dem 20. Dezember 1999 wurde das Wettergeschehen durch ein umfangreiches Tiefdruckgebiet bei Island geprägt. Dieses Tief wurde an den folgenden Tagen anhaltend mit polarer Kaltluft aus der Arktis und mit Warmluft vom subtropischen Atlantik gespeist.
Am 24. Dezember 1999 wurde der bis dahin vorhandene Hochdruckkeil über Mittel- und Osteuropa vollständig abgebaut. Somit konnte sich die gestreckte, zonale Höhenströmung über den ganzen Nordatlantik hinweg bis nach Mitteleuropa ausdehnen. Ein in dieser Strömung eingelagertes Randtief verlagerte sich von Irland her unter starker Vertiefung zur Nordsee und drehte schliesslich zu den Färöer Inseln ein, wo es die Position und Funktion des steuernden Zentraltiefs übernahm. Dieser Tiefdruckwirbel erhielt dann den Namen „Kurt“. Die Kaltfront von „Kurt“ überquerte am 25. Dezember 1999 die Schweiz, begleitet von Sturmwinden.
An der zum Zentraltief „Kurt“ gehörenden Frontalzone, die sich mittlerweile über den ganzen Atlantik erstreckte, entwickelte sich am späten 24. Dezember 1999 südlich von Neufundland in der unteren Troposphäre eine frontale Welle, deren Luftdruck anfänglich 1005 hPa betrug. Unter stetiger Verstärkung verlagerte sich die frontale Welle innerhalb eines optimalen Umfeldes mit anhaltender Zufuhr von Polarluft sowie von feucht-warmer subtropischer Luft ostwärts. Am 25. Dezember 1999 hatte die bereits zu einer Sekundärzyklone weiterentwickelte Welle einen Kerndruck von 995 hPa. Bis zu diesem Zeitpunkt deutete noch nichts auf eine so extreme Entwicklung hin, wie sie dann am Folgetag eintrat.

Am 26. Dezember 1999 00 UTC befand sich das Sekundärtief, aus dem später das Orkantief Lothar entstand, etwa 300 km südlich von Irland und wies einen Kerndruck von 985 hPa auf. In den nachfolgenden sechs Stunden fand eine Entwicklung statt, die in Europa mindestens in den letzten 30 Jahren zuvor noch nie beobachtet worden war. Der Luftdruck im Zentrum des Sekundärtiefs, das sich über Rouen (F) nördlich von Paris befand, fiel um 25 hPa auf 960 hPa. In Rouen selbst wurde ein Druckfall von 26 hPa innerhalb drei Stunden gemessen! Mit der extremen Vertiefung nahmen auch die Windgeschwindigkeiten zu und erreichten über Frankreich bereits Orkanstärke. Diese aussergewöhnliche Entwicklung wurde ermöglicht durch:
- Eine sehr stark ausgebildete, zonal ausgerichtete Frontalzone mit grossen Temperaturgegensätzen, was wiederum zu einer sehr starken Höhenströmung (Jetstream) führte.
- Die optimale vertikale Anordnung und damit die Interaktion zwischen dem Jetstream und dem Bodentief.
- Die anhaltende Zufuhr von subtropischer Luft, die reich an Wasserdampf war und über die freigesetzte latente Wärme einen wesentlichen Beitrag zur starken Vertiefung lieferte.
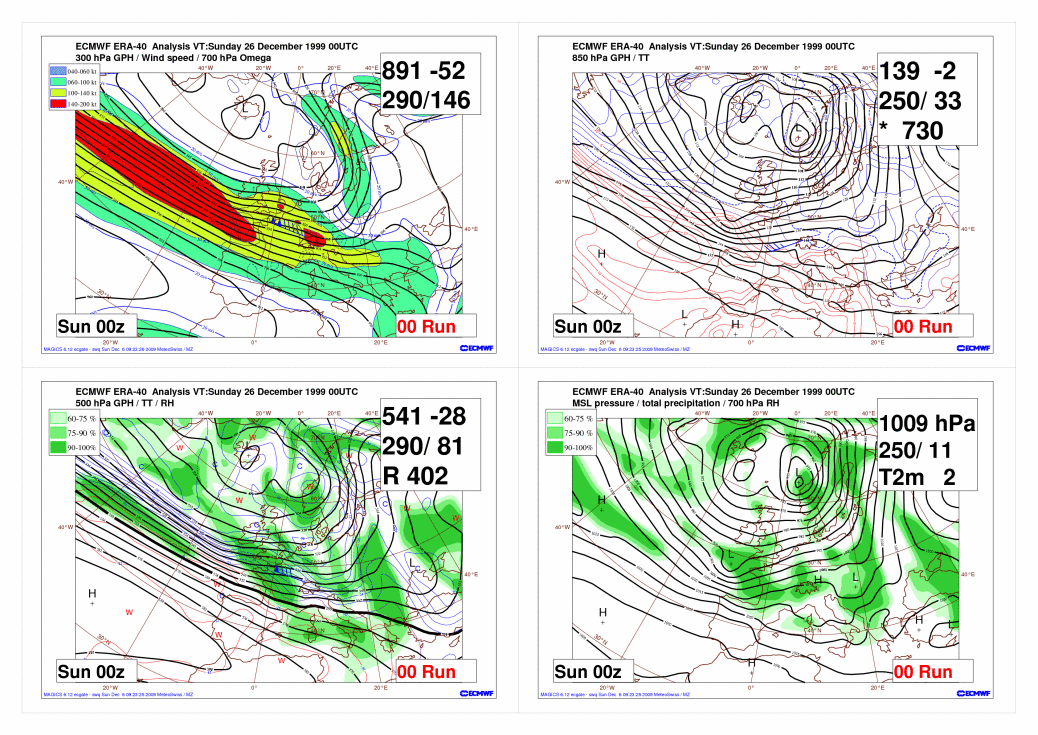
Nach 06 UTC am 26. Dezember 1999 zog das Orkantief Lothar rasch weiter ostwärts über Mitteleuropa hinweg. Dabei traten die stärksten und verheerendsten Winde im südlichen Sektor des Tiefs auf. Die Orkanwinde und die Kaltfront erreichten am späten Vormittag die Schweiz und überzogen bis kurz nach Mittag die ganze Alpennordseite. Lothar füllte sich zu dieser Zeit schon allmählich auf und hatte über Mitteldeutschland noch einen Kerndruck von 975 hPa (Abbildung 2). Von Deutschland verlagerte sich Lothar nach Polen, wo er sich weiter auffüllte. Dabei nahmen die Windgeschwindigkeiten und die Zerstörungskraft deutlich ab. Die sehr starke westliche Höhenströmung blieb aber bestehen, so dass sich noch ein weiteres Randtief zu einem Orkan entwickeln konnte. Dieses Orkantief namens Martin zog vom 27. auf den 28. Dezember 1999 auf einer etwas südlicheren Zugbahn ostwärts und verursachte hauptsächlich in Südwestfrankreich grosse Schäden, wobei auch die Westschweiz noch randlich davon betroffen wurde.
Abbildung 4: Satellitenbild-Animation von Orkan Lothar (26.12.1999 bis 27.12.1999 00 UTC)
-
Ostatlantik: Die Animation beginnt um 00 UTC mit der Bildung von Lothar über dem Ostatlantik. Aus einem sogenannten Wellentief entwickelt sich sehr rasch das Sturmtief Lothar.
-
Rascher Vorstoss: Lothar verlagert sich in der Folge unter weiterer Vertiefung rasch gegen das europäische Festland.
-
Durchzug über Europa: Der Sturm erreicht in den frühen Morgenstunden das europäische Festland und zieht in der Folge als Orkan über Frankreich und die Mitte Deutschlands hinweg gegen Tschechien und Polen. Die für starke Stürme charakteristische, spiralförmige Wolkenformation ist deutlich sichtbar.
07:31 Uhr: "Interview Radio DRS1: Weise darauf hin, dass ich noch nie eine solche Tiefentwicklung so nahe und so stark gesehen habe. Es sei ein besonders heftiger Sturm zu erwarten. Verhaltenshinweise gegeben. Merkwürdig, dass die Moderatorin nicht nachhakt." 07:35 Uhr: "Obwohl jetzt bereits eine ganze Reihe von Stellen über den Sturm informiert sind, bleibt es absolut ruhig bei uns. Kaum ein Anruf, in dem nähere Angaben zum erwarteten Sturm eingeholt werden. Wieso will niemand etwas von unserem Sturm wissen?”
Meteorologe Gaudenz Truog, verantwortlicher Schichtleiter des Prognosedienstes am 26. Dezember 1999.
Lothar über der Schweiz
Die Kaltfront des Orkans erfasste die Schweiz um etwa 09:00 UTC im Bereich des Neuenburger Juras. Ungewöhnlich keilförmig ausgeprägt überquerte sie in der folgenden halben Stunde die Jurahöhen (Abbildung 5). In La Brévine erreichte die Windspitze 157 km/h, in Delémont gar 170 km/h. Selbst auf dem 1600 m ü.M. liegenden Chasseral wurden mit 177 km/h nur unwesentlich höhere Windspitzen gemessen.
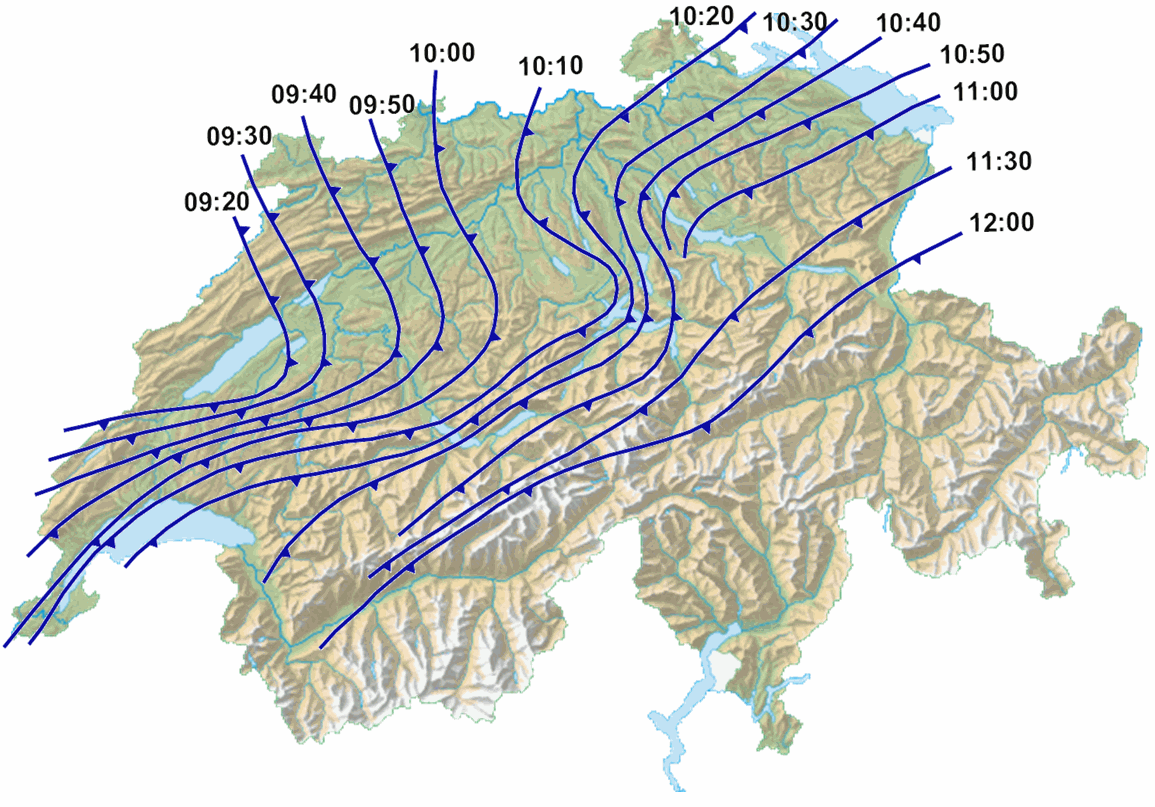
Schneller Vorstoss ins Mittelland
Nach der Überwindung des Jura wälzte sich die Kaltfront mit enormer Geschwindigkeit hinab ins westliche Mittelland und stiess immer noch keilförmig gegen Osten zur Zentralschweiz vor. Die Keilspitze bewegte sich offenbar phasenweise mit einer Geschwindigkeit von rund 150 km/h. Denn zwischen 10.00 und 10.10 UTC, knapp 20 Minuten nach der Juraüberquerung, erreichte der östliche Teil der Kaltfront bereits die Innerschweiz. Zur gleichen Zeit liess der südliche Abschnitt der Kaltfront Bern hinter sich und begann nur wenig später in die Alpen vorzudringen.
08.30-08.40h: "Zweiter Wetterbericht für Radio und Telefon 162 redigiert und vermittelt. Zusatzhinweis im Flash: Achtung: Aus Westen zeitweise heftige Sturmwinde. In allgemeiner Lage: Ein heftiger Sturm wird über die Alpennordseite hinwegfegen mit Windspitzen von 90-150 km/h im Flachland und 120-200 km/h in höheren Lagen."
Meteorologe Gaudenz Truog, verantwortlicher Schichtleiter des Prognosedienstes am 26. Dezember 1999.
Gleichzeitig heftiger Föhn über den Alpen
Kurz nach 10.00 UTC verlangsamte sich die Vorwärtsbewegung der Kaltfront auf der Ostseite. In der Zentralschweiz stiess Lothar auf den Föhn. Verursacht durch das nördlich der Schweiz vorbeiziehende Tiefdruckzentrum, baute sich über dem Alpenraum ein grosses Süd-Nord Druckgefälle auf. Dies löste vor der herannahenden Front vorübergehend eine heftige Föhnströmung aus.
Während sich die Kaltfront in der Zentralschweiz verlangsamte, wälzten sich die Luftmassen entlang des Thuner- und Brienzersees mit grosser Wucht ins Berner Oberland hinein. Dabei stieg in Brienz die Windspitze auf den ausserordentlich hohen Wert von 181 km/h. Bis gegen 10.30 UTC konnte sich schliesslich eine breite Kaltfront entlang des westlichen Alpennordhangs und über das zentrale Mittelland formieren (Abbildung 5).
Das Berner Oberland war die einzige Region, in welcher die Kaltfront grossflächig etwas tiefer ins Alpeninnere vorzustossen vermochte. Allerdings kann der Verlauf der Kaltfront hier nur lückenhaft rekonstruiert werden, da lediglich die Messstationen Boltigen (Simmental) und Adelboden zur Verfügung standen. Boltigen wurde von der Kaltfront mit Windspitzen von über 150 km/h um etwa 10.30 UTC erreicht. In Adelboden hingegen traten die maximalen Windspitzen von 120 km/h bereits vor 10.00 UTC auf, und zwar aus Richtung Südsüdwest. Es scheint demnach, dass in gewissen Tälern des Berner Oberlands nicht die vorrückende Kaltfront, sondern der durch das Sturmtief ausgelöste Föhn die höchsten Windspitzen entwickelte.
Schneller Abzug über die Ostschweiz
Durch die schnelle Ostwärtsverlagerung des Tiefdruckzentrums über Deutschland erhielt die Kaltfront eine west-östliche Ausrichtung. Während sie sich in der Zentralschweiz nur langsam Richtung Osten bewegte, stiess sie in knapp einer Stunde vom Rhein Richtung Süden bis zum Alpennordrand vor. Durch diese sogenannte schleifende Südwärtsbewegung der Kaltfront wurde die Ostschweiz in kurzer Zeit grossflächig vom Orkan erfasst, und die kalten Luftmassen wurden als Folge des Druckanstiegs im Mittelland mit hoher Geschwindigkeit ab ca. 12.00 UTC ins Reuss- und ins Rheintal gedrängt.
11.15-11.45h: "Der Sturm überquert fahrplanmässig Zürich. Es wird schwarz über dem Üetliberg, dann die unglaublich heftigen Windstösse, Fenster zittern, starker Regen. Bei uns nichts von Verwüstungen zu sehen. Doch von alldem kriege ich relativ wenig mit. Zuviel Arbeit ist zu erledigen."
Meteorologe Gaudenz Truog, verantwortlicher Schichtleiter des Prognosedienstes am 26. Dezember 1999.
Wie häufig ist ein Sturm von der Stärke Lothars zu erwarten?
Aktuelle statistische Analysen zur Häufigkeit von hohen Windgeschwindigkeiten in der Schweiz liegen von einer grösseren Anzahl von Messreihen für die Messperiode 1982-2022 vor.
Aus diesen Analysen wird ersichtlich, dass ein Sturm der Stärke Lothars im Flachland der Alpennordseite im Durchschnitt etwa alle 30 bis alle 100 Jahre zu erwarten ist. An mehreren Messstandorten war es ein Sturmereignis mit einer Wiederkehrperiode von 50 bis 100 Jahren, und an einzelnen Messstandorten ergeben sich Wiederkehrperioden von über 100 Jahren.
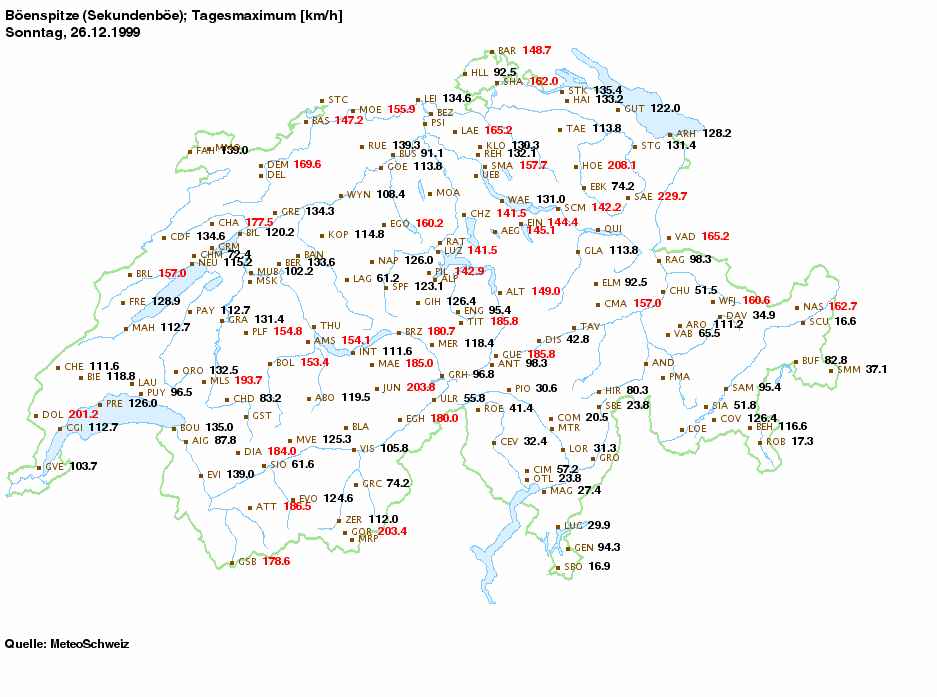
14.00-14.40h: "Diskussion, Aufbereitung des Ereignisses. Einführung Spätdienstmeteorologe." 14.40h: "Feierabend, ausgelaugt, müde. Die Gedanken kreisen weiter. Habe ich alles gemacht, was in meinen Möglichkeiten stand? Was wäre besser gewesen? Wo hätte ich anders reagieren sollen?"
Meteorologe Gaudenz Truog, verantwortlicher Schichtleiter des Prognosedienstes am 26. Dezember 1999. Gaudenz Truog arbeitete von 1965 bis 2004 als Prognostiker bei MeteoSchweiz.
Von der Objektwarnung zu einem modernen Warnsystem
Interview mit Saskia Willemse, Teamleiterin Warnsysteme

Saskia, du warst während des Orkans Lothar als Meteorologin im Einsatz. Auf dem Dach der MeteoSchweiz wurde eine Böenspitze von 158 km/h gemessen. Wie hast du diesen extremen Sturm erlebt?
Ich hatte an diesem Tag Spätdienst. Als die stärksten Böen über Zürich fegten, war ich noch zu Hause und unterschätzte das Ausmass der Schäden, da ich in einer windgeschützten Lage wohnte. Erst auf dem Weg zur Wetterzentrale, als viele Strassen durch umgestürzte Bäume blockiert waren, wurde mir klar, wie gravierend die Situation war.
In der Wetterzentrale sah ich auf den Prognosemodellen ein Tiefdruckgebiet, das wie eine Zielscheibe aussah – so ein ausgeprägtes Tief hatte ich noch nie gesehen. Die Modelle waren damals weniger zuverlässig, und das volle Ausmass des Orkans wurde erst klar, als die ersten Messungen aus Frankreich eintrafen.
Auch mit besseren Prognosen wäre die Warnung für die Bevölkerung allerdings schwierig gewesen: Es gab keine standardisierten Warnstufen oder definierten Warnregionen. Informationen wurden fast ausschliesslich über Radiointerviews verbreitet, nur für Seen und Flughäfen gab es institutionalisierte Kanäle.
Die Unwetterserie von 1999 löste in der Schweiz die Entwicklung moderner Warnsysteme aus. Statt nur Seen und Flugplätze zu warnen, gibt es heute ein mehrstufiges System für 159 Regionen. Doch wie gut sind wir wirklich auf Unwetter vorbereitet?
In den letzten 25 Jahren hat sich viel getan: Die Vorhersage von Extremereignissen, die Verbreitung von Warnungen und die Koordination der Warnprozesse wurden stark verbessert. Kurz nach 2000 ging ein erstes landesweites Warnsystem in Betrieb, das 14 Regionen abdeckte.
Das Starkniederschlagsereignis vom August 2005 führte zum nächsten Entwicklungsschritt: Der Lenkungsausschuss Intervention Naturgefahren (LAINAT) wurde gegründet, um Warnungen besser zu koordinieren und zentral zu kommunizieren. Gleichzeitig genehmigte der Bundesrat das erste OWARNA-Massnahmenpaket, das eine Erneuerung des Radar- und Bodenmessnetzes ermöglichte und die Warnregionen von 14 auf 159 erhöhte.
Mit OWARNA 2 (das im Jahr 2019 vom Bundesrat genehmigt wurde) wird das Warnsystem gegenwärtig weiterentwickelt: Neue Software, Automatisierung von Arbeitsschritten, verbesserte Inhalte und optimierter Austausch mit den kantonalen Behörden sind zentrale Massnahmen.
1999 gab es kaum Warnsysteme für die Bevölkerung, heute wird sie von allen Seiten gewarnt. Wie siehst du diese Entwicklung?
Heute können wir deutlich besser warnen als 1999 – ein grosser Fortschritt. Doch die Vielzahl an Kanälen und Herausgebern führt dazu, dass die Bevölkerung von Warnungen regelrecht überflutet wird. MeteoSchweiz hat den gesetzlichen Auftrag, vor Unwettern zu warnen, doch auch andere Institutionen und private Dienstleister geben Warnungen aus. Diese verbreiten sich über Apps, Websites, Social Media und Online-Medien. Zu viele Warnungen mindern jedoch ihre Wirkung und können ihren Charakter als «Weckruf» verlieren.
Zu viele Warnungen können die Öffentlichkeit desensibilisieren, sodass sie im Ernstfall nicht mehr reagiert. MeteoSchweiz warnt aber auch die kantonalen Behörden. Wie funktioniert diese Warnkette?
Kantonale Behörden erhalten ab der dritten Warnstufe (Orange) die gleichen Warnungen wie die Bevölkerung, jedoch auch zusätzliche Dienstleistungen. Vor etwa zwei Jahren wurde das «Remote Briefing für Behörden» eingeführt. Bei dieser Videokonferenz erklären Prognostiker:innen die Wetterlage und damit verbundene Unsicherheiten im Warnfall. Die teilnehmenden Behördenvertreter können dabei Fragen zur Wetterentwicklung stellen und sich direkt austauschen. Diese Dienstleistung von MeteoSchweiz hat viele positive Rückmeldungen erhalten.
Das föderale System sieht vor, dass die Kantone lokale Warnungen mit Informationen zu Auswirkungen und Verhaltensempfehlungen herausgeben. Dafür hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz für die Kantone die Plattform AlertSwiss entwickelt. Da dort nur die Warnungen der Kantone publiziert werden, aber die Plattform dennoch als Bundesplattform erkennbar ist, bleibt oft unklar, von wem die Warnungen stammen.
Die föderale Struktur sieht zudem vor, dass die Kantone die Gemeinden über Naturgefahren informieren, doch dies wird von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt. Gemeinden sind oft die ersten, die bei Unwettern die Bewältigung übernehmen müssen. In einigen Kantonen erhalten sie die Warnungen von MeteoSchweiz jedoch nicht über die kantonalen Behörden, sondern müssen sich über öffentliche Kanäle informieren.
Sind Unwetterwarnungen nur dann effektiv, wenn die Verbreitungskanäle und die beteiligten Behörden sowie Interventionskräfte gut aufeinander abgestimmt sind?
Ja, das tragische Beispiel von Valencia (Spanien) Ende Oktober 2024 zeigt, was passieren kann, wenn die Warnkette nicht lückenlos funktioniert. Eine Unwetterwarnung allein reicht nicht aus - sie muss die richtigen Adressaten erreichen, klar verständlich sein und die Betroffenen müssen wissen, wie sie angemessen reagieren. Erst dann ist eine Warnung effektiv.
Der Wetterdienst warnt vor Gefahren des Wetters und gibt allgemeine Verhaltensempfehlungen. Die Behörden müssen die Lage lokal einschätzen und Schutzmassnahmen ergreifen. Dazu müssen sie in «ruhigen Zeiten» ihre Krisenorganisation üben und sicherstellen, dass sie im Notfall effektiv mit der Bevölkerung kommunizieren können.
Das Wallis und die Alpensüdseite, besonders das Maggiatal und das Misox, wurden diesen Sommer mehrfach von schweren Unwettern heimgesucht, die grosse Schäden anrichteten und leider auch Opfer forderten. Hat die Warnkette bei diesen Ereignissen funktioniert?
Dies wird derzeit in einer umfassenden Untersuchung geprüft, an der sowohl Bundesinstitutionen als auch Vertretende der betroffenen Kantone beteiligt sind, weshalb ich mich hierzu nicht äussern möchte.
Was ich jedoch sagen kann, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Prognosezentrum der MeteoSchweiz in Locarno-Monti und den kantonalen Behörden in der Regel gut funktioniert. Sie kommunizieren direkt und haben eingespielte Abläufe, was durch die exklusive Zuständigkeit für den Kanton Tessin und die Bündner Südtäler erleichtert wird. In der Deutschschweiz und in der Romandie ist dies schwieriger, da z.B. das Prognosezentrum in Zürich-Kloten 19 Kantone und Halbkantone bedient, die jeweils unterschiedlich arbeiten.
Unwetterwarnungen bleiben auch in den kommenden Jahren ein relevantes Thema. So erreichte das Wort „Murgang“ Platz 3 der ZHAW-Rangliste Wort des Jahres 2024, und „allerta meteo“ belegte den 2. Platz in der italienischsprachigen Schweiz. Wie wird sich das Warnsystem bei MeteoSchweiz weiterentwickeln?
Die Adressaten von Unwetterwarnungen wollen vor allem wissen "was das Wetter machen wird” und weniger „wie das Wetter wird“.
In Zukunft wird der Fokus neben der Verbesserung der Erkennung von Extremwetterereignissen verstärkt auf der Vorhersage möglicher Auswirkungen liegen. Dies betrifft sowohl direkte Schäden wie zerstörte Strassen oder Gebäude als auch indirekte Folgen wie Verkehrsbehinderungen.
Solche Vorhersagen können nicht pauschal gemacht werden, sondern nur gezielt für bestimmte Anwendungsfälle und basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Die Form und der Inhalt dieser Auswirkungsinformationen müssen daher in enger Zusammenarbeit mit den Endnutzenden – in diesem Fall den kantonalen Behörden – entwickelt werden.
Die Warnungen werden also auch in Zukunft nicht exakt sein?
Trotz aller Verbesserungen in unseren Warnsystemen bleibt eine gewisse Unsicherheit bestehen. Dies gilt nicht nur in der Meteorologie, sondern auch bei anderen Prognosen wie Wirtschaftsvorhersagen.
Wettervorhersagen und Unwetterwarnungen sind keine exakten Fahrpläne, wie etwa ein Zugfahrplan. Selbst bei einem Fahrplan kann ein unvorhergesehenes Ereignis wie zum Beispiel eine Fahrleitungsbeschädigung Unregelmässigkeiten verursachen.
Mit Unsicherheiten werden wir trotz den Fortschritten auch in der Zukunft leben müssen.
Weiterführende Informationen
- 25 Jahre nach Lothar: Wie der Orkan den Wald umbaute - Blogartikel Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL
- Annalen MeteoSchweiz 1999 - Kapitel 4 "Besondere Wetterereignisse" Rückblick auf das Unwetterjahr 1999
- VIVIAN (Sturmperiode Februar 1990) - Der äusserst starke Winter-Weststurm vom 27. Februar 1990 (Vivian) brachte die im schweizerischem Netz bisher höchste gemesssene Windspitze von 269 km/h auf dem Gr. St. Bernhard und enorme Waldschäden. Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 182, 1995
- Der Wintersturm Burglind/Eleanor in der Schweiz - Am Vormittag des 3. Januar 2018 erfasste der Sturm Burglind/Eleanor grosse Teile der Schweiz. Es war der stärkste Wintersturm seit Lothar 1999 und brachte vor allem im Jura und im Flachland der Alpennordseite aussergewöhnlich starke Winde. Fachbericht MeteoSchweiz Nr. 268, 2018
- Lothar, der Orkan 1999, Ereignisanalyse (PDF via sturmarchiv.ch) - Herausgeber Eidg. Forschungsanstalt WSL und Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, 2001
- SRF Club - Schäden nach Orkan Lothar - Diskussion über die durch Orkan "Lothar" entstandenen Sturmschäden
- SRF Tagesschau Archiv - Vor zwanzig Jahren wütete Orkan «Lothar»
- La Tempête du Siècle - Lothar & Martin Décembre 1999 - Eindrücklicher DOK über Lothar mit Fokus Frankreich und die Prognosen von Météo France (YouTube-Video: 01:30 Std). PRODUCTEUR: Gedeon Programmes / France 3, France 5, CFI, TV5 DATE: 2004
- Tempête Lothar Vevey 1999 - Meterhohe Wellen und Überschwemmungen an der Seepromenade in Vevey (YouTube-Video)